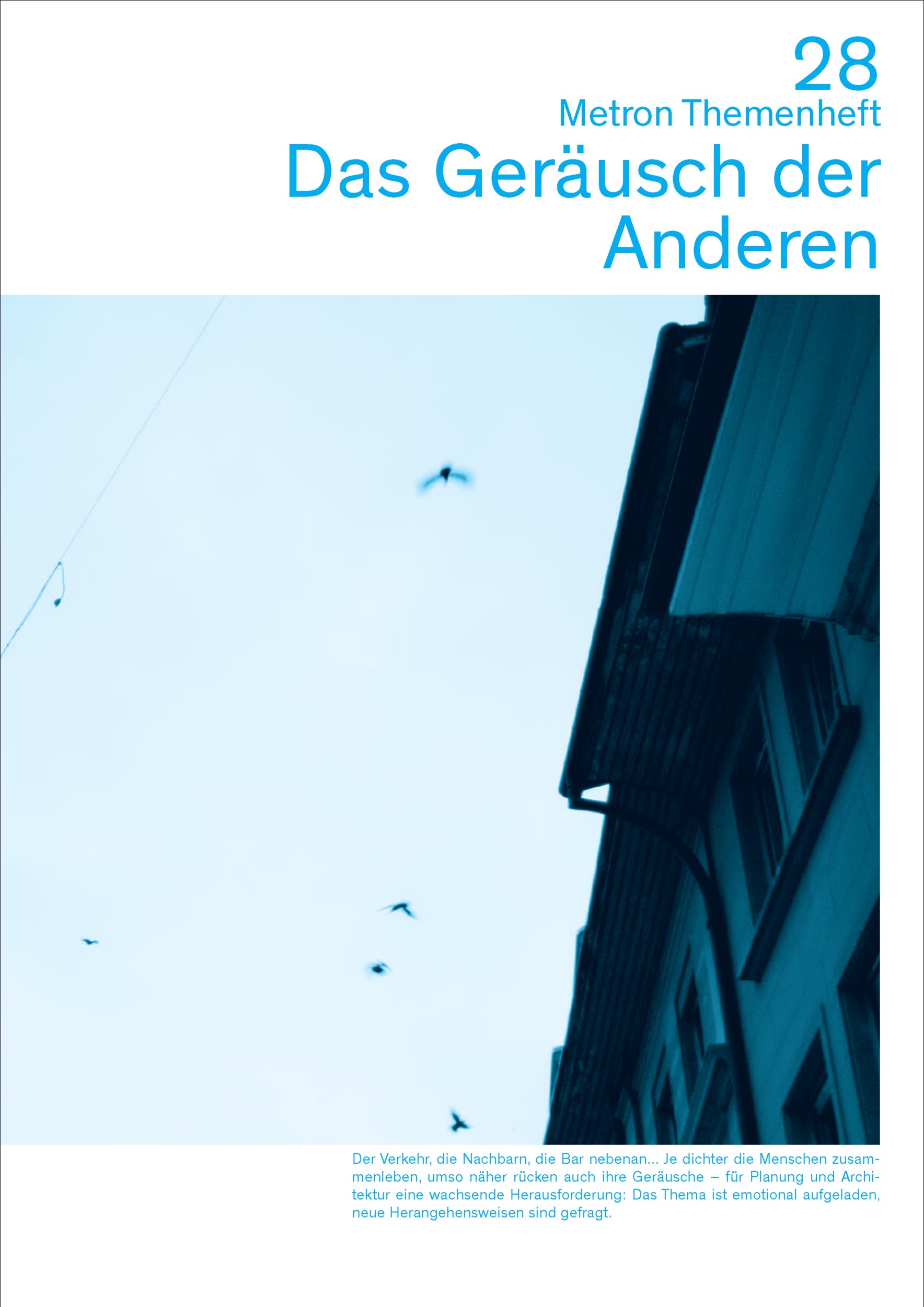Heute sind in der Schweiz täglich über 1.3 Mio. Menschen übermässigem Lärm ausgesetzt. Das fällt umso mehr ins Gewicht, als das Ohr ein immer offenes Sinnesorgan ist und sich im Unterschied zum Auge nicht einfach schliessen lässt. Was können Planung und Architektur erreichen, und mit welchen Mitteln? Brauchen wir die Polizeistunde wieder, einen Schalter, der der 24-Stunden-Gesellschaft ein Time-out auferlegt? Ruheinseln? Mehr Milliarden für technisch perfekte Schallschutzlösungen? Oder vor allem mehr Toleranz? Müssen wir unsere Einstellung ändern?
Des Einen Freud, des Andern Leid …
Was trotz berechtigten Forderungen nach umfassendem Lärmschutz nicht vergessen werden darf: Lärm kann belastend sein, Stille auch. Alltagsgeräusche sind wichtig, um sich zu orientieren und am sozialen Leben teilzunehmen. «Geräusch anhören, ist an fremdem Leben teilnehmen.» schrieb Kurt Tucholsky. Beim Lärmkonflikt wird ausserdem eine Grundfrage des gesellschaftlichen Zusammenlebens berührt: Inwiefern sollen oder müssen Tätigkeiten des einen verboten werden, damit ein anderer in seiner Freiheit, oder seiner Gesundheit, nicht eingeschränkt wird? Das ist ein demokratischer Ausmarchungsprozess, der schwierig ist. So kann man beispielsweise sagen, Kirchenglocken stören, ebenso kann man aber die Auffassung vertreten, sie seien schon immer dagewesen und gehörten zu unserer Kultur. Die Freiheit desjenigen, der ohne Lärmbelästigung schlafen möchte, steht gegen die Freiheit desjenigen, der Kirchenglocken als Kulturgut betrachtet, als Teil seiner Identität.
Lösungsansätze für die Planung
Mit Inhalten, Zielen und Grenzen des Lärmschutzes befassen sich die Autoren des vorliegenden Heftes aus architektonischer, planerischer, psychologischer, soziologischer und rechtlicher Sicht. Dabei kommen neben unterschiedlichen Lösungsansätzen direkt an der Lärmquelle auch nichtakkustische Faktoren zur Sprache. Sie sind zwar rechtlich schwer fassbar, haben aber einen grossen Einfluss auf das Lärmempfinden und müssen deshalb in der Planung berücksichtigt werden. So sind etwa Runde Tische zentraler Punkt bei der psychologischen Lärmbekämpfung: Frühzeitige Information schafft Toleranz, auch wenn das Spektrum der Angebote, die gemacht werden können, klein ist.